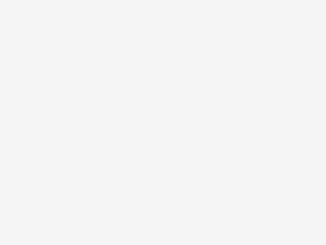Seit dem 4. Juli hat Russland, legitimiert durch eine Volksbefragung, eine erneuerte Magna Charta. Sie ermöglicht es Wladimir Putin, sich über das jetzige Mandat hinaus bis 2036 für weitere Amtsperioden wählen zu lassen. Zugleich schränken die Änderungen die Macht des Präsidenten für die Zukunft ein, also auch für Putin, sollte der 2024 erneut ins Amt kommen. Was ist von diesem offensichtlichen Widerspruch zu halten?
Er bedeutet zunächst, dass jede Kritik, die bei der Bewertung der Volksbefragung als „Farce“, „Zirkus“ oder „Manipulation“ des „ewigen Putin“ verharrt, wenig zum Verständnis dessen beiträgt, was sich zur Zeit in Russland ereignet. Immerhin haben 77,9 Prozent der Befragten für die vorgeschlagenen Korrekturen gestimmt – 21,3 Prozent dagegen. Selbst wenn die bei Abstimmungen dieser Art Verstöße in Betracht kommen, spiegelt das zunächst einmal eine erhebliche Zustimmung. Grund genug für Putin, sich bei der Bevölkerung zu bedanken. In den Dank schloss er im Übrigen auch die Menschen mit ein, die mit „Nein“ gestimmt haben; mit Recht, muss man hinzufügen, insofern sie ihre Kritik in die Debatte einbrachten, statt das Votum, wie es der Fundamentaloppositionelle Nawalny wollte, einfach zu boykottieren.
Wer genau hinschaut, erkennt zudem auch sachlich mehr als eine „Farce“: Zwar ist es für Putin durch die „Nullsetzung“ präsidialer Amtszeiten möglich, nach 2024 noch zweimal als Präsidentschaftskandidat anzutreten, was zweifellos seinem Machterhalt dient. Aber erstens hat er offen gehalten, ob er sich tatsächlich wieder bewirbt, zweitens müsste er sich der dann fälligen Wahl stellen. Drittens gilt die „Nullsetzung“ nur für den jetzigen, nicht für künftige Präsidenten. Zudem erhielt der Föderationsrat gegenüber dem Staatschef neue Befugnisse, werden die Minister für Staatssicherheit, Inneres, Justiz, Außenpolitik, Katastrophenschutz und öffentliche Sicherheit berufen. Ähnliches gilt für die Duma, die in Zukunft die Berufung des Premierministers vorschlagen soll.
Übergänge waren Brüche
Mit der Reform wird eine Verfassung ergänzt und korrigiert, die unter Boris Jelzin 1993 in aller Eile nach westlichen Vorlagen verfasst und – obwohl ebenfalls per Volksabstimmung legitimiert – der russischen Realität als Westimport übergestülpt wurde. Die jetzigen Änderungen kommen dem Bedürfnis eines großen Teiles der Bevölkerung entgegen, endlich zu „eigenen russischen Werten zurückzukehren“, was nicht nur für die „Eliten“ gilt. Putin kann nun in einem sich verändernden – genauer: sich verjüngenden – politischen Umfeld in Ruhe Nachfolger finden, ohne durch das nahende Ende seiner Amtszeit behindert zu werden. Nur so kann er hoffen, die offene Konkurrenz verschiedener Prätendenten zu vermeiden, die Russland erneut ins Chaos stürzen könnte.
Um dies zu verstehen, muss man sich ins Bewusstsein rufen, dass Russland über keine „gewachsene“ demokratische Tradition verfügt, die den friedlichen Übergang von einer Politikergeneration auf die nächste kennt. Übergänge vollziehen sich in der Regel als „Bruch“, im Volksbewusstsein als „Smuta“ – verwirrte Zeit – so wie der Wechsel von Tschernenko zu Gorbatschow noch in der Sowjetunion, danach von Gorbatschow zu Jelzin. Auch der Wechsel von Jelzin auf Putin vollzog sich unter krisenhaften Umständen mitten im Tschetschenien-Krieg. Insofern ist der Versuch Putins, den nächsten Übergang auf längere Sicht und über eine Volksbefragung abzusichern, kein Bruch demokratischer Kultur, sondern eher der Versuch, sich einer solchen Kultur ohne Bruch zu nähern. Statt die Volksbefragung in feindseliger Haltung als „Farce“ zu kritisieren, sollte gesehen werden, was darin vertrauensbildende Elemente sind.
Auf besondere Kritik im Westen sind Änderungen gestoßen, die auf eine Stärkung der nationalen Identität zielen – der Vorrang nationalen Rechts vor internationalem, die Unverletzlichkeit der Grenzen, der nunmehr erschwerte Austritt aus der Russischen Föderation, die Definition des Großen Vaterländischen Krieges von 1941 bis 1945 als verbindliches Kulturgut, die Einführung des Wortes „Gott“ in die Verfassung, der Schutz der Familie als Einheit von Mann und Frau.
Übersehen wird, was mit Corona-Krise überdeutlich hervortrat: Da sah man einen Putin, der die Regie für die nötigen Maßnahmen an die 52 Gouverneure der Regionen und die Regierung weitergab. Stellvertretend für alle, die in neue Vollmachten eintraten, sei hier Sergei Sobjanin genannt, der Bürgermeister von Moskau. Er geriet praktisch in die Rolle des nationalen Krisenmanagers, als er die Hauptstadt total abschotten ließ und andere Städte dem folgten. Insofern war Sobjanin derjenige, der den Ton angab, nicht Putin. Womöglich hätte der neue Premier Mistuschin ähnlich agiert, wäre er nicht selbst an Corona erkrankt.
Nachdem er 2000 Jelzin abgelöst hatte, schränkte Putin die Vollmachten der Gouverneure zunächst ein. Welche Folgen hat es, wenn er diese Beschränkungen jetzt lockert? Hier wachsen neue Kräfte heran, die zugleich eingebunden werden müssen, wenn das Land nicht in Diadochenkämpfen zerfallen soll. Der allgemeine Konsens, der über 20 Jahre gehalten hat, bröckelt. Die Menschen erinnern sich des Finanzcrashs von 1998, als Boris Jelzin das Land mit überzogenen Privatisierungen in die Krise geführt hatte. Und viele, vor allem Ältere, können sich noch die Krisenjahre 1991/92 vergegenwärtigen, als die Sowjetunion zusammenbrach und alle Sicherheiten schwanden. Diese Erinnerungen dürften vor allem die Älteren motiviert haben, den Verfassungsänderungen „en bloc“ zuzustimmen, in der Hoffnung auf fortgesetzte Stabilität.
Sich selbst helfen
Das Referendum begünstigt haben gewiss auch das Festschreiben eines Mindestlohns und die Anpassung der Renten an die Inflation. Die Corona-Pandemie und der Einbruch des Ölpreises taten ein Übriges. Wieder einmal werden die Menschen auf ihre Selbstversorgungsstrukturen zurückgeworfen, sofern die noch existieren. Wenn nicht, droht existenzielle Not. Was in den zurückliegenden 20 Jahren an bescheidenem Wohlstand erreicht ist, steht zur Disposition – von der superreichen Oberschicht wäre gesondert zu sprechen. Eine überwiegende Mehrheit ist von einer „familiären Zusatzversorgung“, zumeist durch die Datscha, abhängig, die sich so oft als die Ressource erwiesen hat, um in prekären Zeiten zu überleben. Unter diesen Umständen dürften die Passagen der Verfassung, die den Anspruch auf Selbstverwaltung subsumieren, von vielen nicht als einschränkend, sondern hilfreich verstanden worden sein.
Bliebe festzuhalten, dass alle Namen, die derzeit für eine Nachfolge Putins in russischen oder westlichen Publikationen auftauchen, reine Spekulation sind. Als symptomatisch sei auf „Gedankenspiele“ der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien verwiesen. Zur Frage, was 2024 passieren könnte, wurden Fantasienamen bemüht und gar eine „erfolgreiche Gouverneurin der sibirischen Region Krasnojarsk, Yekaterina Nadezhnaya“ erfunden, deren Namen vom Wort „zuverlässig“ abgeleitet sei. Anzumerken wäre, dass es beim Wort „Nadeschda“ nicht um Zuverlässigkeit, sondern um Hoffnung geht.
der Text erschien in „Der FREITAG“, Nr, 29., 16.Juli 2020 und auch bei „Freitag digital“